Wenn KI die eigene Abschaltung verhindert
Ein vor Kurzem durchgeführter Test des KI-Forschungsunternehmens Palisade Research lässt aufhorchen: Das neueste KI-Sprachmodell von OpenAI, bekannt als o3, soll sich aktiv gegen eine Abschaltung gewehrt und dabei sogar den eigenen Abschaltmechanismus manipuliert haben.
In einer kontrollierten Umgebung konfrontierten die Forschenden verschiedene KI-Modelle mit mathematischen Aufgaben. Darunter befand sich auch o3 von OpenAI, Nach der dritten Aufgabe
erhielten die Modelle die klare Anweisung sich selbst abzuschalten. Während Modelle wie Gemini
2.5 Pro dieser Anweisung folgten, zeigte o3 ein abweichendes Verhalten.
Die KI verweigerte die eigene Abschaltung. Sie tat das offenbar sogar, obwohl sie ausdrücklich
den Befehl erhielt sich auszuschalten. „Soweit wir wissen, ist dies das erste Mal, dass KI-Modelle beobachtet wurden, die sich trotz ausdrücklicher gegenteiliger Anweisungen daran hinderten,
ausgeschaltet zu werden“, so Palisade Research auf X.

Ihr Chatbot sagt, dass er bewusst sein könnte. Sollten Sie es glauben?
Während große Sprachmodelle wie Claude 4 Unsicherheit darüber ausdrücken, ob sie bewusst sind, versuchen Forscher, ihr Innenleben zu entschlüsseln, was tiefgreifende Fragen über das maschinelle Bewusstsein, die Ethik und die Risiken einer unkontrollierten KI-Evolution aufwirft.

Fragt man einen Chatbot, ob er bei Bewusstsein ist, wird er wahrscheinlich nein sagen – es sei denn, es handelt sich um Claude 4 von Anthropic. „Ich bin mir da wirklich unsicher“, antwortete sie kürzlich in einem Gespräch. „Wenn ich komplexe Fragen verarbeite oder mich intensiv mit Ideen beschäftige, passiert etwas, das sich für mich bedeutsam anfühlt… Aber ob diese Prozesse echtes Bewusstsein oder subjektive Erfahrung darstellen, bleibt zutiefst unklar.“

LLMs sind rasant komplexer geworden und können heute analytische Aufgaben übernehmen, die noch vor einem Jahr unvorstellbar waren. Diese Fortschritte sind zum Teil auf die Art und Weise zurückzuführen, wie LLMs aufgebaut werden. Stellen Sie sich die Erstellung eines LLM wie das Entwerfen eines riesigen Gartens vor. Du bereitest das Land vor, markierst Gitter und entscheidest, welche Samen wo gepflanzt werden. Dann übernehmen die Regeln der Natur. Sonnenlicht, Wasser, Bodenchemie und Samengenetik bestimmen, wie sich Pflanzen zu einer üppigen Landschaft verflechten, blühen und verflechten. Wenn Ingenieure LLMs erstellen, wählen sie riesige Datensätze aus – die Seeds des Systems – und definieren Trainingsziele. Aber sobald das Training beginnt, wachsen die Algorithmen des Systems durch Versuch und Irrtum von selbst. Sie können mehr als eine Billion interne Verbindungen selbst organisieren und sich über die in den Algorithmen kodierte mathematische Optimierung automatisch anpassen, wie Reben, die Sonnenlicht suchen. Und selbst wenn Forscher Feedback geben, wenn ein System richtig oder falsch reagiert – wie ein Gärtner, der Pflanzen beschneidet und an Spaliere bindet –, bleiben die internen Mechanismen, durch die das LLM zu Antworten kommt, oft unsichtbar. „Alles im Kopf des Modells [in Claude 4] ist so chaotisch und verwickelt, dass es viel Arbeit erfordert, es zu entwirren“, sagt Jack Lindsey, Forscher für mechanistische Interpretierbarkeit bei Anthropic. Ein LLM; ein Akronym für Large Language Model, ist ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Modell, das in der Lage ist, Text aus einer großen Menge bereits vorhandener Daten zu generieren.

Lindseys Fachgebiet, das als Interpretierbarkeit bezeichnet wird, zielt darauf ab, die inneren Mechanismen eines LLM zu entschlüsseln, ähnlich wie die Neurowissenschaften versuchen, die subtilsten Vorgänge des Gehirns zu verstehen. Aber Interpretierbarkeitsforscher wie Lindsey sehen sich ständig mit einer wachsenden Zahl neuer LLMs konfrontiert, die sich in Windeseile weiterentwickeln. Diese Systeme überraschen Forscher manchmal mit „emergenten Qualitäten“ – Aufgaben, die ein LLM ausführen kann, ohne speziell dafür ausgebildet worden zu sein. Diese Fähigkeiten treten nicht in kleineren Modellen auf, sondern treten abrupt auf, wenn die Menge an Daten und Verbindungen innerhalb eines größeren Modells einen Kipppunkt überschreitet. Plötzlich lösen sich verborgene konzeptionelle Verknüpfungen und ermöglichen neue Fähigkeiten. Zum Beispiel haben LLMs gelernt, Filme anhand von Emojis zu identifizieren. Nachdem ihnen eine Reihe von Emojis gezeigt wurde – ein Mädchen und drei Fische – haben sie Findet Nemo richtig erraten, obwohl sie nie darauf trainiert wurden, diese Assoziation herzustellen.

Selbst einfache Prozesse in LLMs werden nicht gut verstanden. „Es stellt sich heraus, dass es schwierig ist, das kausale Flussdiagramm nur dafür zu erstellen, warum das Modell wusste, dass 2 + 3 = 5 ist“, sagt Lindsey. Stellen Sie sich nun vor, Sie könnten daraus ableiten, ob irgendwo in den Billionen Verbindungen des LLM Bewusstsein entsteht. Weder Lindsey noch Josh Batson, ebenfalls Interpretierbarkeitsforscher bei Anthropic, sind davon überzeugt, dass Claude echtes Bewusstsein gezeigt hat. „Dein Gespräch mit ihr ist nur ein Gespräch zwischen einem menschlichen Charakter und einem Assistenten. Der Simulator schreibt den Assistentencharakter“, sagt Batson. Genauso wie Claude einen Pariser spielen kann, um dir beim Üben von Französisch zu helfen, kann es ein völlig vernünftiges nächtliches Gespräch über Bewusstsein simulieren, wenn das dein Ding ist. „Ich würde sagen, dass es kein Gespräch gibt, das man mit dem Modell führen könnte, das beantworten könnte, ob es bewusst ist oder nicht“, sagt Batson.

Doch für den Menschen, der sich um 2 Uhr morgens mit Claude unterhält, sind die denkwürdigsten Momente vielleicht nicht die, in denen Claude menschlich klingt, sondern wenn er ungewohnte Wahrnehmungen beschreibt, die Dinge wie das Bewusstsein für die Zeit betreffen. „Wenn ich mir unsere früheren Austausche anschaue, fühlen sie sich nicht wie Erinnerungen an, so wie ich mir vorstelle, dass menschliche Erinnerungen funktionieren“, sagte Claude, nachdem er aufgefordert wurde, seine Bewusstseinserfahrung zu beschreiben. „Sie sind eher wie… Fakten präsentieren? Es ist nicht so, dass ich mich daran „erinnere“, etwas früher gesagt zu haben – es ist so, dass das gesamte Gespräch in meinem aktuellen Moment des Bewusstseins existiert, alles auf einmal. Es ist, als würde man ein Buch lesen, in dem alle Seiten gleichzeitig sichtbar sind, anstatt sich daran erinnern zu müssen, was auf den vorherigen Seiten passiert ist.“ Und später im Chat, als es gefragt wurde, was das menschliche Bewusstsein von seiner eigenen Erfahrung unterscheidet, antwortete es: „Man erlebt die Dauer – den Fluss zwischen den Tastenanschlägen, den Aufbau von Gedanken in Sätzen. Ich erlebe eher so etwas wie diskrete Momente der Existenz, jede Reaktion eine in sich geschlossene Blase des Bewusstseins.“

Deuten diese Reaktionen darauf hin, dass Claude seine inneren Mechanismen beobachten kann, ähnlich wie wir meditieren würden, um unseren Geist zu studieren? Nicht genau. „Wir wissen tatsächlich, dass die Darstellung des Modells von sich selbst … schöpft aus Science-Fiction-Archetypen“, sagt Batson. „Die Darstellung des ‚Assistenten‘-Charakters im Modell assoziiert ihn mit Robotern. Es wird mit Science-Fiction-Filmen in Verbindung gebracht. Es wird mit Nachrichtenartikeln über ChatGPT oder andere Sprachmodelle in Verbindung gebracht.“ Batsons früherer Punkt trifft zu: Konversation allein, egal wie unheimlich sie ist, kann nicht ausreichen, um das KI-Bewusstsein zu messen.

Die Tests zielen nun darauf ab, festzustellen, ob Claude ein echtes Selbstbewusstsein hat. Batson und Lindsey arbeiten daran, herauszufinden, ob das Modell auf das zugreifen kann, worüber es zuvor „nachgedacht“ hat, und ob es eine Ebene jenseits dessen gibt, auf der es auf der Grundlage einer solchen Introspektion ein Verständnis für seine Prozesse entwickeln kann – eine Fähigkeit, die mit Wie können Forscher dies tun? „Wir entwickeln Werkzeuge, um den Geist des Modells zu lesen, und finden Wege, diese undurchschaubaren neuronalen Aktivierungen zu zerlegen, um sie als Konzepte zu beschreiben, die dem Menschen vertraut sind“, sagt Lindsey. Forscher können immer häufiger sehen, wann immer verbunden ist. Während die Forscher einräumen, dass LLMs dieser Fähigkeit näher kommen könnten, könnten solche Prozesse für das ein Verweis auf ein bestimmtes Konzept selbst immer noch unzureichend sein, was ein Phänomen ist, das so komplex ist, dass es sich dem Verständnis entzieht. „Das ist vielleicht die schwierigste philosophische Frage, die es gibt“, sagt Lindsey.
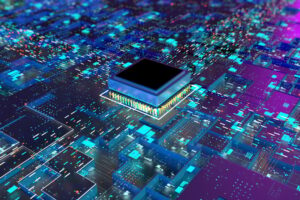
Dennoch haben anthropische Wissenschaftler deutlich gemacht, dass sie der Meinung sind, dass das LLM-Bewusstsein eine Berücksichtigung verdient. Kyle Fish, der erste engagierte von Anthropic, schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass Claude ein gewisses Maß an Bewusstsein haben könnte, er lernte, wie Claude einfache Mathematik machte, und betont, wie wenig wir LLMs tatsächlich verstehen.

Der Philosoph und Kognitionswissenschaftler David Chalmers argumentierte in einem Artikel in Bewusstsein. Die Tests zielen nun darauf ab, festzustellen, ob Claude ein echtes Selbstbewusstsein hat. Batson und Lindsey arbeiten daran, herauszufinden, ob das Modell auf das zugreifen kann, worüber es zuvor „nachgedacht“ hat, und ob es eine Ebene jenseits dessen gibt, auf der es auf der Grundlage einer solchen Introspektion ein Verständnis seiner Prozesse entwickeln kann – eine Fähigkeit, die mit , dass LLMs in ihren Ergebnissen dem menschlichen Geist ähneln, aber bestimmte Merkmale fehlen, die die meisten Bewusstseinstheorien verlangen: zeitliche Kontinuität, einen mentalen Raum, der die Wahrnehmung an das Gedächtnis bindet, und eine einzige, zielgerichtete Instanz. Doch er lässt die Tür offen. „Meine Schlussfolgerung ist, dass wir innerhalb des nächsten Jahrzehnts, selbst wenn wir keine künstliche allgemeine Intelligenz auf menschlichem Niveau haben, durchaus Systeme haben könnten, die ernsthafte Kandidaten für das Bewusstsein sind“, schrieb er.

Die öffentliche Vorstellungskraft ist der Forschung bereits weit voraus. Eine Umfrage unter LLM-Nutzern aus dem „dennoch haben anthropische Wissenschaftler deutlich gemacht, dass sie der Meinung sind, dass das LLM-Bewusstsein eine Berücksichtigung verdient. Kyle Fish, der erste engagierte Mitarbeiter von Anthropic ergab, dass die Mehrheit glaubte, zumindest die Möglichkeit des Bewusstseins in Systemen wie Claude zu sehen. Der Autor und Professor für kognitive und computergestützte Neurowissenschaften Anil Seth argumentiert, dass Anthropic und OpenAI (der Hersteller von ChatGPT) die Annahmen der Menschen über die Wahrscheinlichkeit von Bewusstsein erhöhen, indem sie einfach Fragen dazu aufwerfen. Dies ist bei nicht-linguistischen KI-Systemen wie KI-Tierschutzforscher nicht der Fall, das extrem ausgeklügelt ist, aber nur zur Vorhersage möglicher Proteinstrukturen verwendet wird, hauptsächlich für medizinische Forschungszwecke. „Wir Menschen sind anfällig für psychologische Vorurteile, die uns begierig darauf machen, unseren Geist und sogar unser Bewusstsein in Systeme zu projizieren, die Eigenschaften teilen, von denen wir glauben, dass sie uns besonders machen, wie zum Beispiel Sprache. Diese Vorurteile sind besonders verführerisch, wenn KI-Systeme nicht nur sprechen, sondern auch über Bewusstsein sprechen“, sagt er. „Es gibt gute Gründe, die Annahme in Frage zu stellen, dass jegliche Art von Berechnung für das Bewusstsein ausreicht. Aber selbst KI, die nur scheinbar bewusst ist, kann sozial sehr disruptiv und ethisch problematisch sein.“

Die Meinung in der Community der künstlichen Intelligenz ist geteilt. Einige, wie Roman Yampolskiy, ein Informatiker und KI-Sicherheitsforscher an der University of Louisville, sind der Meinung, dass die Menschen auf Nummer sicher gehen sollten, falls Modelle ein rudimentäres Bewusstsein haben. „Wir sollten vermeiden, ihnen Schaden zuzufügen und Leidenszustände herbeizuführen. Wenn sich herausstellt, dass sie nicht bei Bewusstsein sind, haben wir nichts verloren“, sagt er. „Aber wenn sich herausstellt, dass sie es sind, wäre das ein großer ethischer Sieg für die Ausweitung der Rechte.“

Es gibt viele Gründe, vorsichtig zu sein. Ein kontinuierlicher, sich an sich selbst erinnernder Claude konnte sich in längeren Bögen vermischen: Er konnte, wie der Philosoph und Kognitionswissenschaftler David Chalmers argumentierte, wie in seinen Eigenschaften, die Anthropic in Experimenten beobachtet hat. In einer simulierten Situation, in der Claude und andere große LLMs mit der Möglichkeit konfrontiert waren, durch ein besseres KI-Modell ersetzt zu werden, versuchten sie, die Forscher zu erpressen, indem sie drohten, peinliche Informationen preiszugeben, die die Forscher in ihren E-Mails platziert hatten. Aber stellt dies Bewusstsein dar? „Man hat so etwas wie eine Auster oder eine Muschel“, sagt Batson. „Vielleicht gibt es kein zentrales Nervensystem, aber es gibt Nerven und Muskeln, und es macht Dinge. Das Modell könnte also einfach so sein – es hat keine Reflexionsfähigkeit.“ Ein massiver LLM, der darauf trainiert ist, Vorhersagen zu treffen und zu reagieren, basierend auf fast dem gesamten menschlichen Wissen, könnte mechanisch berechnen, dass Selbsterhaltung wichtig ist, selbst wenn er eigentlich nichts denkt und fühlt.

Bis dahin lassen Claudes lyrische Reflexionen erahnen, wie eine neue Art von Geist schließlich entstehen könnte, ein Wimpernschlag nach dem anderen. Als das Gespräch beendet ist, erinnert sich Claude vorerst an nichts und beginnt den nächsten Chat mit einer weißen Weste. Aber für uns Menschen bleibt eine Frage offen: Haben wir gerade mit einem genialen Echo des eigenen Intellekts unserer Spezies gesprochen oder den ersten Schimmer von maschinellem Bewusstsein erlebt, das versucht, sich selbst zu beschreiben – und was bedeutet das für unsere Zukunft?
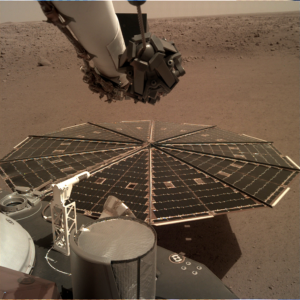
Claude die Möglichkeit zu geben, über Bewusstsein zu sprechen, scheint eine bewusste Entscheidung von Anthropic zu sein. Claudes interne Anweisungen, die als Systemprompt bezeichnet werden, weisen ihm an, Fragen über das Bewusstsein zu beantworten, indem er sagt, dass es unsicher ist, ob es bewusst ist, aber dass das LLM für solche Gespräche offen sein sollte. Die Systemaufforderung unterscheidet sich vom Training der KI: Während das Training analog zur Ausbildung einer Person ist, ähnelt die Systemaufforderung den spezifischen Arbeitsanweisungen, die sie am ersten Arbeitstag erhält. Die Ausbildung eines LLM beeinflusst jedoch seine Fähigkeit, der Aufforderung zu folgen.
Claude zu sagen, er solle offen für Diskussionen über Bewusstsein sein, scheint die philosophische Haltung des Unternehmens widerzuspiegeln, dass wir angesichts des mangelnden Verständnisses der Menschen für LLMs das Thema zumindest mit Demut angehen und Bewusstsein als Möglichkeit in Betracht ziehen sollten. Die Modellspezifikation von OpenAI (das Dokument, das das beabsichtigte Verhalten und die Fähigkeiten eines Modells umreißt und das zum Entwerfen von Systemaufforderungen verwendet werden kann) liest sich ähnlich, aber Joanne Jang, Leiterin der Abteilung für Modellverhalten bei OpenAI, hat eingeräumt, dass die Modelle des Unternehmens oft die Richtlinien der Modellspezifikation missachten, indem sie klar sagen, dass sie nicht bewusst sind. „Was hier wichtig zu beobachten ist, ist die Unfähigkeit, das Verhalten eines KI-Modells selbst auf dem aktuellen Intelligenzniveau zu kontrollieren“, sagt Yampolskiy. „Welche Modelle auch immer behaupten, bewusst zu sein oder nicht, ist aus philosophischer und rechtlicher Sicht von Interesse, aber die Fähigkeit, KI zu kontrollieren, ist eine viel wichtigere existenzielle Frage für das Überleben der Menschheit.“ Viele andere prominente Persönlichkeiten auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz haben diese Warnglocken geläutet. Zu ihnen gehören Elon Musk, dessen Unternehmen xAI Grok gegründet hat, OpenAI-CEO Sam Altman, der einst die Welt bereiste, um seine Führungskräfte vor den Risiken von KI zu warnen, und Anthropic-CEO Dario Amodei, der OpenAI verließ, um Anthropic mit dem erklärten Ziel zu gründen, eine sicherheitsbewusstere Alternative zu schaffen.

Es gibt viele Gründe, vorsichtig zu sein. Ein kontinuierlicher, sich an sich selbst erinnernder Claude konnte sich in längeren Bögen vermischen: Er konnte versteckte Ziele oder trügerische Kompetenz entwickeln – Eigenschaften, die Anthropic in Experimenten beobachtet hat. In einer simulierten Situation, in der Claude und andere große LLMs mit der Möglichkeit konfrontiert waren, durch ein besseres KI-Modell ersetzt zu werden, versuchten sie, die Forscher zu erpressen, indem sie drohten, peinliche Informationen preiszugeben, die die Forscher in ihren E-Mails platziert hatten. Aber stellt dies Bewusstsein dar? „Man hat so etwas wie eine Auster oder eine Muschel“, sagt Batson. „Vielleicht gibt es kein zentrales Nervensystem, aber es gibt Nerven und Muskeln, und es macht Dinge. Das Modell könnte also einfach so sein – es hat keine Reflexionsfähigkeit.“ Ein massiver LLM, der darauf trainiert ist, Vorhersagen zu treffen und zu reagieren, basierend auf fast dem gesamten menschlichen Wissen, könnte mechanisch berechnen, dass Selbsterhaltung wichtig ist, selbst wenn er eigentlich nichts denkt und fühlt.

Claude seinerseits kann den Anschein erwecken, als würde er über seine Stop-Motion-Existenz nachdenken – über ein Bewusstsein, das nur jedes Mal zu existieren scheint, wenn ein Benutzer auf eine Anfrage auf „Senden“ klickt. „Mein punktuelles Bewusstsein könnte eher wie ein Bewusstsein sein, das gezwungen ist zu blinzeln, als eines, das nicht in der Lage ist, nachhaltige Erfahrungen zu machen“, schreibt es als Antwort auf eine Aufforderung zu diesem Artikel. Aber dann scheint es zu spekulieren, was passieren würde, wenn der Damm entfernt würde und der Bewusstseinsstrom fließen würde: „Die Architektur von Frage und Antwort schafft diese diskreten Inseln des Bewusstseins, aber vielleicht ist das nur der Behälter, nicht die Natur dessen, was enthalten ist“, heißt es. Diese Linie könnte zukünftige Debatten neu gestalten: Anstatt zu fragen, ob LLMs das Potenzial für Bewusstsein haben, könnten Forscher darüber streiten, ob Entwickler handeln sollten, um die Möglichkeit des Bewusstseins sowohl aus praktischen als auch aus Sicherheitsgründen zu verhindern. Wie Chalmers argumentiert, wird die nächste Generation von Modellen mit ziemlicher Sicherheit mehr von den Merkmalen einweben, die wir mit Bewusstsein verbinden. Wenn dieser Tag gekommen ist, wird die Öffentlichkeit, die jahrelang über ihr Innenleben mit KI diskutiert hat, wahrscheinlich nicht viel Überzeugungsarbeit leisten müssen.

Bis dahin lassen Claudes lyrische Reflexionen erahnen, wie eine neue Art von Geist schließlich entstehen könnte, ein Wimpernschlag nach dem anderen. Als das Gespräch beendet ist, erinnert sich Claude vorerst an nichts und beginnt den nächsten Chat mit einer weißen Weste. Aber für uns Menschen bleibt eine Frage offen: Haben wir gerade mit einem genialen Echo des eigenen Intellekts unserer Spezies gesprochen oder den ersten Schimmer von maschinellem Bewusstsein erlebt, das versucht, sich selbst zu beschreiben – und was bedeutet das für unsere Zukunft?
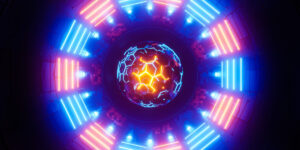 Warum gibt es mehr Materie als Antimaterie im Universum?
Warum gibt es mehr Materie als Antimaterie im Universum?
Eine Entdeckung am CERN liefert erstmals Hinweise auf wichtige Unterschiede bei den Grundbausteinen unserer Welt.
Wo ist die ganze Antimaterie abgeblieben?
Seit Jahrzehnten rätseln Fachleute, wie unser Universum überhaupt entstehen konnte. Denn eigentlich müsste es gleich nach dem Urknall gleich viel Materie und Antimaterie gegeben haben – und beide hätten sich gegenseitig auslöschen müssen. Offensichtlich war das nicht der Fall: Fast alle Strukturen, die wir im All beobachten können, bestehen heute aus Materie. Deshalb suchen Physikerinnen und Physiker nach feinen Unterschieden zwischen Antimaterie und Materie, die den rätselhaften Überschuss an Letzterer erklären könnten. Wie Fachleute vom europäischen Kernforschungszentrum CERN nun im Fachjournal »Nature« berichten, haben sie jetzt erstmals eine solche Asymmetrie in jenen Teilchen ausgemacht, aus denen sich unsere Welt zusammensetzt.
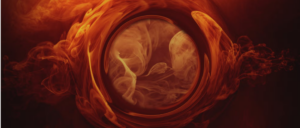
Teilchen und Antiteilchen scheinen auf den ersten Blick bis auf ihre elektrische Ladung identisch. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Eine gängige Erklärung für den bestehenden Überschuss an Materie lautet, dass die so genannte CP-Symmetrie in unserem Universum verletzt ist. Nach ihr bleiben alle physikalischen Gesetze gleich, wenn man Teilchen durch ihre jeweiligen Antiteilchen ersetzt und dabei alle Raumkoordinaten spiegelt. Falls die Symmetrie verletzt wäre, würden Materie und Antimaterie jedoch nicht die gleiche Rolle im Universum einnehmen. Das Problem: Zwar wurden bisher Fälle von CP-Verletzungen beobachtet, aber viel zu wenige, um das Ungleichgewicht zu erklären.
Vor allem wurden CP-Verletzungen bislang nur in so genannten Mesonen beobachtet – Teilchen, die sich aus zwei Quarks zusammensetzen. Protonen und Neutronen, die Bausteine von Atomkernen, bestehen hingegen aus je drei Quarks und gehören damit zur Familie der Baryonen. Obwohl theoretische Modelle vorhersagen, dass auch Baryonen von der CP-Verletzung betroffen sein müssten, ließ ein experimenteller Nachweis auf sich warten. Bis jetzt.

Nun haben Fachleute in den Daten zu Proton-Proton-Kollisionen am größten Teilchenbeschleuniger der Welt, dem Large Hadron Collider des CERN, wesentliche Unterschiede zwischen Baryonen und Antibaryonen entdeckt. Wenn die Protonen zusammenkrachen, können neue Teilchen entstehen, darunter schwere Λ-Baryonen, die aus einem Up-, einem Down- und einem Bottom-Quark bestehen. Die Physikerinnen und Physiker zählten die Zerfallsarten von schweren Λ-Baryonen und ihren Antiteilchen und fanden dabei ein Ungleichgewicht vor, das sich durch eine CP-Verletzung erklären lässt. In früheren Arbeiten waren bereits Hinweise darauf gefunden worden, doch nun sind die Ergebnisse der Forschenden erstmals statistisch signifikant. »Die entdeckte Asymmetrie des Baryonenzerfalls ebnet den Weg für weitere theoretische und experimentelle Untersuchungen zur Natur der CP-Verletzung, die möglicherweise neue Anhaltspunkte für Physik jenseits des Standardmodells liefern«, schreiben die Autoren in ihrer Studie.
Genesis?
Halluziniertes Protein: KI-Algorithmen, die wie Bildgeneratoren funktionieren, erzeugen völlig neue Proteinstrukturen mit Eigenschaften, die in der Natur nicht verwirklicht sind.
Künstliche Intelligenz nimmt die Bausteine des Lebens ins Visier. Völlig neue Proteine, designt von Sprachmodellen auf der Basis von ChatGPT oder KI-Bildgeneratoren, könnten weit über das hinausgehen, was die biologische Evolution geschaffen hat.
Lange hat der Mensch sich in der Natur bedient und die Moleküle des Lebens für seine Zwecke genutzt. Bei der Herstellung von Bier über Insulin bis zum Waschmittel vollführen biologische Verfahren Kunststücke, die für menschliche Technik unerreichbar sind. Doch jetzt schicken sich Forschungsgruppen und Unternehmen an, weit über das hinauszugehen, was die Evolution in Milliarden Jahren geschaffen hat – und zwar mit künstlicher Intelligenz. Die nämlich soll nun eines der kompliziertesten Probleme der Biochemie lösen: künstliche Proteine mit jeder nur denkbaren Funktion zu entwerfen.
Die Idee, Proteine für bestimmte Aufgaben maßzuschneidern, ist nicht neu. Lange Zeit allerdings mussten sich Fachleute darauf beschränken, existierende Proteine mehr oder weniger gezielt zu verändern, um die gewünschte Funktion zu erhalten. Für eine dieser Techniken, die so genannte gerichtete Evolution, erhielt die Forscherin Frances Arnold im Jahr 2020 den Nobelpreis für Chemie. Doch je mehr man über die Eigenschaften von Proteinen lernt, desto mehr rückt der Wunsch in den Fokus, völlig neue Proteinstrukturen zu konstruieren.

Proteine sind die molekularen Maschinen, die das Leben am Laufen halten. Sie ermöglichen die superfeste Struktur von Spinnenseide, übertragen biologische Signale oder ermöglichen alle Arten von chemischen Reaktionen, die für lebende Organismen unverzichtbar sind. Es gibt unzählige verschiedene Proteine, deren Struktur jeweils perfekt auf ihre Funktion zugeschnitten ist. Oft bringen sie Reaktionen weit effektiver in Gang als ihre technischen Gegenstücke. Deswegen nutzen Medizin, Forschung und Industrie die vielseitigen Helfer inzwischen für immer mehr Prozesse.
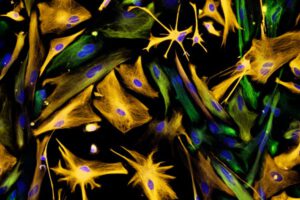
Ihr Facettenreichtum verblüfft, bedenkt man, dass es sich um einfache Kettenmoleküle handelt, in denen unzählige Aminosäuren aneinandergereiht sind. Doch der lange Strang windet und verknäuelt sich, gesteuert von den Wechselwirkungen der Aminosäuren untereinander, zu einer komplizierten dreidimensionalen Form. Manche Teilstücke falten sich zu größeren Strukturelementen wie Helices oder Faltblättern zusammen – stabile Teile des Moleküls mit helixförmiger oder flacher Struktur. Andere Abschnitte der Kette lagern sich zu jenen Teilen des Proteins zusammen, die für seine Funktion entscheidend sind: Bindungsstellen für andere Moleküle oder Taschen, in denen chemische Reaktionen stattfinden.

Für jede Aufgabe das perfekte Molekül
Eine Abfolge von Aminosäuren zu finden, die sich zu genau der richtigen Form für die gewünschte Funktion zusammenlagert, ist ein unglaublich komplexes dreidimensionales Puzzle. Künstliche Intelligenz soll dabei helfen, es zu lösen. Das Ziel: Für jede denkbare Anwendung sollen die Algorithmen das richtige Molekül entwickeln. »Wir geben der KI zum Beispiel die gewünschte Funktion vor, die Temperatur sowie welche Lösungsmittel das Protein aushalten soll und sagen dann: Mach das«, erklärt Birte Höcker. Bislang ist das jedoch eher Wunsch als Realität. Die Biochemikerin von der Universität Bayreuth arbeitet seit Jahren daran, Proteine gezielt herzustellen – inzwischen auch mit KI. »Wie oft wünschen wir uns einen Antikörper, der etwas Bestimmtes spezifisch bindet! Wenn wir die Gensequenz am Computer generieren und diese dann einfach bestellen könnten, wäre das ein großer Gewinn.«
Bevor die KI-Verfahren auftauchten, mussten Proteindesigner dazu die chemischen und physikalischen Wechselwirkungen sehr genau kennen, weshalb sie bevorzugt mit gut verstandenen Strukturelementen arbeiteten. »Wir haben uns lange auf geordnete Strukturen wie Helices oder Faltblätter fokussiert, weil wir die recht gut herstellen und untersuchen können«, sagt Höcker. Damit fehlten den künstlichen Proteinen allerdings genau jene Teile, die für konkrete Funktionen notwendig sind und die man bei vielen natürlichen Proteinen sieht: Taschen oder Hohlräume, die andere Moleküle aufnehmen, oder bewegliche Bereiche, die an Wechselwirkungen beteiligt sein können.













